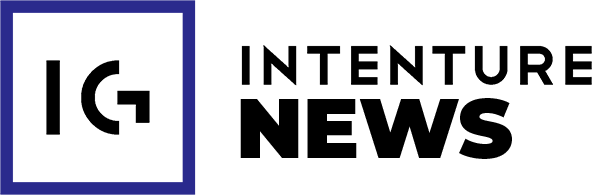Zwei aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs verschärfen die Anforderungen an die Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG – Gesellschaftergruppen ohne rechtliche Organisation scheitern, Fünfjahresfristen bleiben strikt.
Gesellschafterkreis ohne Rechtsform genügt nicht als herrschendes Unternehmen
Der Bundesfinanzhof stellte mit Urteil vom 21. Mai 2025 (Az. II R 56/22) klar, dass mehrere Gesellschafter, die nur gemeinsam die 95-Prozent-Schwelle erreichen, nicht als herrschendes Unternehmen im Sinne der Konzernklausel gelten. Die Entscheidung betraf eine Abspaltung zur Neugründung, bei der eine von mehreren Gesellschaftern gehaltene Firma ihre Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft auf eine neu gegründete Klägerin übertrug. Finanzamt und Finanzgericht beurteilten den Vorgang nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG als steuerpflichtig, da sämtliche Anteile auf die Klägerin übergingen. Der BFH bestätigte: Obwohl § 6a Satz 1 GrEStG keine bestimmte Rechtsform vorschreibt, erfüllt eine nicht in Form einer Personen- oder Kapitalgesellschaft organisierte Gesellschaftergruppe nicht die Voraussetzungen. Erreicht kein einzelnes Gruppenmitglied die 95-Prozent-Beteiligung, existiert kein herrschendes Unternehmen. Der BFH ließ allerdings offen, ob eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder andere Gesellschaftsformen mit aggregierten Beteiligungen als herrschendes Unternehmen fungieren könnte – ein möglicher Gestaltungsspielraum für künftige Umwandlungen.
Verzicht auf Fünfjahresfrist ausgeschlossen
Im zweiten Urteil vom 21. Mai 2025 (Az. II R 31/22) verneinte der BFH die Möglichkeit, auf die Einhaltung der Fünfjahresfrist zu verzichten, wenn die Fristeinhaltung rechtlich möglich gewesen wäre. Eine Kommune hatte den Betrieb einer Versammlungshalle samt Grundstück auf eine kurz zuvor neu gegründete Gesellschaft abgespalten. Die Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG scheiterte, weil die Kommune keine mindestens fünfjährige Beteiligung am aufnehmenden Unternehmen vor der Umwandlung hielt. Die Kommune argumentierte mit der BFH-Rechtsprechung zur teleologischen Reduktion der Fristen, da die Gesellschaft ausschließlich für die Abspaltung gegründet worden sei. Der BFH wies dies zurück. Zwar entschied der BFH früher, dass Fristen nur insoweit gelten, wie dies aufgrund des Umwandlungsvorgangs möglich ist. Bei Abspaltung zur Neugründung ist dies umwandlungsbedingt unmöglich. Diese Grundsätze greifen jedoch nicht, wenn die Gesellschaft bereits existierte. Bei Abspaltung auf eine existierende Gesellschaft wäre Fristeinhaltung rechtlich möglich gewesen – eine teleologische Einschränkung scheidet daher aus. Die Urteile bestätigen die enge Auslegung bei umwandlungsbedingter Unmöglichkeit. Dies erfordert sorgfältige Planung bei immobilienbezogenen Restrukturierungen, wobei Umwandlungsrecht dennoch vielfältige Gestaltungsoptionen bietet.
Verwandte Artikel
Aktuelle Stellenangebote
Meistgelesene Artikel
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei: