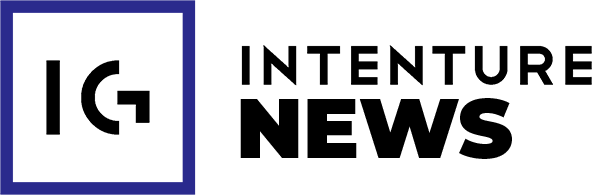Recruiter, die nach bisherigen Bezügen fragen, verstoßen gegen Datenschutzprinzipien und treiben Kandidaten in strategische Übertreibungen – HR-Experten fordern Umdenken.
Aufrunden als verbreitete Gegenstrategie
Online-Diskussionen in Karriereforen offenbaren eine gängige Praxis: Bewerber erhöhen bei Angaben zu früheren Bezügen systematisch die Zahlen. Ein deutschsprachiger Reddit-Nutzer beschreibt seine Taktik, mehrere Hundert Euro aufzuschlagen, um Verhandlungsspielraum zu schaffen. Die Strategie zahlt sich aus: Selbst nach Abschlägen durch den potenziellen Arbeitgeber landet er über seinem tatsächlichen Ausgangsniveau.
Reto, ein 31-jähriger aus der Schweizer Community, wagte einen 25-Prozent-Aufschlag mit der Begründung existenzieller Notwendigkeit – und erhielt sogar mehr als gefordert. Die Kommentare zeigen: Solche Erfahrungen sind keine Einzelfälle. Ein weiterer Nutzer berichtet von 300 Euro Mehrgehalt durch vergleichbare Taktiken.
Datenschutz als rechtliche Grenze
HR-Spezialist Jörg Buckmann kritisiert die Praxis grundsätzlich: Arbeitgeber sollten die Gehaltsfrage gar nicht stellen, da sie Bewerber in problematische Pokersituationen zwinge. Zudem existiere eine rechtliche Barriere: Frühere Arbeitgeber dürften Gehaltsinformationen nicht weitergeben, da Persönlichkeitsrechte und Datenschutzbestimmungen dies untersagten. Diese rechtliche Einschätzung hat praktische Konsequenzen für Recruiting-Prozesse. Unternehmen können Gehaltsangaben faktisch nicht verifizieren und sollten daher auf andere Bewertungskriterien setzen.
Marktwertorientierung statt historischer Anker
Gudrun Ogris, ebenfalls HR-Expertin, hält frühere Bezüge für irrelevant bei der Gehaltsfindung. Entscheidend seien Qualifikation, Verantwortungsumfang und interne Vergütungsstrukturen – nicht die Historie. Viele Personalverantwortliche rechneten ohnehin mit aufgerundeten Angaben.
Ogris empfiehlt Bewerbern, den eigenen Marktwert zu recherchieren und selbstbewusst zu kommunizieren, ohne auf übertriebene Aufschläge angewiesen zu sein. Buckmann formuliert die Grenze pragmatisch: Strategische Selbstvermarktung sei legitim, offensichtliche Falschaussagen jedoch kontraproduktiv.
Wo Wahrhaftigkeit zählt – und wo nicht
Bei verifizierbaren Fakten wie Abschlüssen, Berufserfahrung oder Sprachkenntnissen warnen beide Experten eindringlich vor Unwahrheiten. Hier drohe sofortiger Glaubwürdigkeitsverlust. Anders bei unzulässigen Fragen zu Privatsphäre: Fragen nach Familienplanung, Religion oder sexueller Orientierung dürften mit Notlügen beantwortet werden, da sie rechtlich unzulässig seien. Ogris warnt zudem vor den Risiken überzogener Gehaltsvorstellungen: Entweder führten sie zur Absage oder zu unrealistischen Erwartungen, die später nicht erfüllbar seien.
Konsequenzen für Kanzleien und Beratungen
Für Professional Services als Arbeitgeber folgt daraus: Gehaltsbänder sollten ausschließlich auf Rolle, Qualifikation und Marktdaten basieren – nicht auf individueller Gehaltshistorie. Die Frage nach bisherigen Bezügen ist datenschutzrechtlich fragwürdig und strategisch wenig zielführend, da sie zu verzerrten Informationen führt. Stattdessen sollten transparente interne Vergütungsstrukturen die Verhandlungsgrundlage bilden – ein Ansatz, der auch der zunehmenden Gehaltsdiskussion in der Branche Rechnung trägt.
Verwandte Artikel
Aktuelle Stellenangebote
Meistgelesene Artikel
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei: