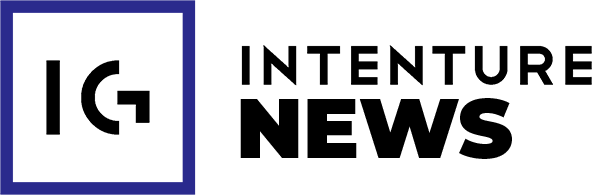Clemens Engelhardt von Trustberg sieht PE als einzige Lösung für überalterten, unterkapitalisierten Steuerberatungsmarkt – Kammerposition ignoriert ökonomische Realität.
Generationenwechsel scheitert an Finanzierungslücke
Der fragmentierte deutsche Steuerberatungsmarkt kämpft mit einem fundamentalen Problem: Ausscheidende Seniorpartner fordern Millionenbeträge für ihre Anteile, während Nachfolger weder Kapital noch Bereitschaft zur Übernahme mitbringen. Gleichzeitig fehlt Geld für IT-Modernisierung und KI-Integration. Clemens Engelhardt, Trustberg-Partner und Wirtschaftsrechtsprofessor, beschreibt eine typische 35-Mitarbeiter-Kanzlei: Junge Steuerberater verweigern Partnerschaften, mittlere Partner sind im Tagesgeschäft gefangen und können sich nicht um Strategie kümmern. Das Partnermodell blockiert sich selbst, so Engelhardt.
Skalierungseffekte durch Kapitalspritze
Buy-and-Build-Investoren könnten das Defizit beheben. Engelhardt rechnet vor: Eine halbe Million Euro jährlich für HR und Digitalisierung plus zwei bis drei Millionen initial würden die Kanzlei transformieren. Der Clou: Zentrale Funktionen skalieren problemlos. Eine HR-Vollzeitstelle betreut 35 oder 100 Mitarbeiter gleich effizient. Genau diese Skalierungslogik beherrschen PE-Häuser perfekt. Entscheidend sei auch die kulturelle Komponente: Steuerberater schütten laut Engelhardt Gewinne aus, statt zu investieren. Langfristige Verschuldung zur Unternehmensentwicklung sei ihnen fremd.
Kammer fürchtet Profitdruck – der längst Realität ist
Die Bundessteuerberaterkammer warnt vor Renditeorientierung durch externe Investoren. Engelhardt hält das für naiv: "Man selektiert Mandate doch jetzt schon nach Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Eine Reinigungsfirma mit vielen Minijobbern und hohem Personalwechsel? Da winken viele Steuerberatungen ab, weil Lohnbuchhaltung komplexe Handarbeit ist und die Marge gering. Und weil heute bereits das Personal hierfür fehlt. Das ist Profitdenken in Reinform.“ Zudem greife das Unabhängigkeitsargument nicht: "Private Equity verdient nicht während der Holdphase, sondern beim Exit. Wenn ich mein Portfoliounternehmen extrem ausquetsche, kann ich es später nicht mit Gewinn verkaufen." Die Exit-Logik erzwinge geradezu nachhaltige Geschäftsmodelle. Außerdem blieben persönliche Haftung und berufsrechtliche Verantwortung unangetastet. "Kein PE-Investor wird sich in einzelne Mandatsentscheidungen einmischen. Dafür fehlt ihm die Kompetenz, und es interessiert ihn auch nicht."
Kammer toleriert Umwege, blockiert transparente Lösung
Paradox findet Engelhardt die Kammerposition: Einerseits lehne man PE kategorisch ab, andererseits signalisiere Kammerpräsident Helmut Schwab Akzeptanz für PE-finanzierte IT-Dienstleister. "Man hat offensichtlich verstanden, dass zusätzliches Kapital gebraucht wird und akzeptiert auch ein System drumherum, in dem die Steuerberatung letzten Endes doch gefangen ist. Aber wäre dann nicht eine Erlaubnis mit Transparenz und Kontrolle sinnvoller?“
WP-Kammer zeigt pragmatischen Weg
Als Vorbild empfiehlt Engelhardt die Wirtschaftsprüfer. Deren Kammer und das IDW stehen PE deutlich offener gegenüber – aus gutem Grund: WPs managten seit Jahrzehnten den Interessenkonflikt, von geprüften Unternehmen bezahlt zu werden und gleichzeitig unabhängig zu sein. Sie wüssten, dass man in Spannungsfeldern arbeiten müsse. Steuerberater würden das gerade erst lernen.“
Aktuelle Stellenangebote
Meistgelesene Artikel
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei: