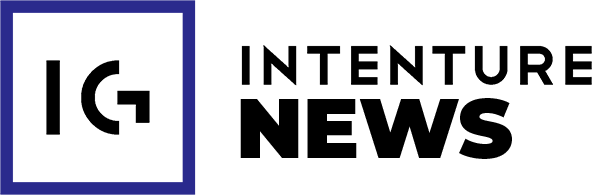Bund und Länder verschieben die verpflichtende elektronische Aktenführung um ein Jahr, während die Anwaltschaft seit 2018 digital arbeitet.
Opt-out-Regelung verschafft Aufschub bis 2027
Der Bundestag beriet kürzlich über den Gesetzentwurf "zur Änderung der Vorschriften über die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz" (BT-Ds. 21/1852). Die nächtliche Debatte symbolisiert treffend das düstere Kapitel der justiziellen Digitalisierung.
Die ursprünglich für 1. Januar 2026 geplante bundesweite E-Akten-Pflicht für Gerichte und Staatsanwaltschaften scheitert flächendeckend. Viele Bundesländer haben keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen. Das neue Gesetz ermöglicht Bund und Ländern via Rechtsverordnung eine "Opt-out"-Verschiebung auf den 1. Januar 2027. Zusätzlich wird der Medienwechsel innerhalb eines Verfahrens ("Hybridakte") flexibilisiert. In Strafsachen bleibt 2026 Papierführung ohne Rechtsverordnung möglich, wenn Ermittlungsbehörden umfangreiche Vorgänge in Papier zuliefern. Aktenberge in der Strafjustiz bleiben somit Realität.
Richterbund kritisiert "Digital-Wüste" Sachsen-Anhalt
Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds (DRB), wertet die Terminverschiebung als Beleg des Scheiterns: "Die Möglichkeit eines nochmaligen Aufschubs für den flächendeckenden Einsatz der elektronischen Akte in der Justiz wirft ein Schlaglicht auf die Versäumnisse der vergangenen Jahre bei der Digitalisierung." Sachsen-Anhalt bleibe nach fast einem Jahrzehnt Vorbereitungszeit in weiten Teilen der Justiz eine Digital-Wüste. Auch in anderen Bundesländern gehe der digitale Wandel zu schleppend voran. "Dazu trägt eine zersplitterte IT-Landschaft in der Justiz bei, die auch den Umstieg auf eine leistungsfähige E-Akte aus einem Guss erschwert."
Rebehn begrüßt zwar Investitionen aus dem "Pakt für den Rechtsstaat", kritisiert aber: "Dass es selbst für das altbekannte Phänomen der Fluggastklagen noch immer keine KI-gestützten Assistenzsysteme zur schnelleren Fallbearbeitung in allen Amtsgerichten gibt, passt nicht zu den hohen Zielen von Bund und Ländern bei der Digitalisierung."
Anwaltschaft seit Jahren digital – Justiz hinkt hinterher
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) überschreibt sein Statement genervt: "Wie lang soll das noch dauern?" Ulrike Silbermann, Vorsitzende des Ausschusses Elektronischer Rechtsverkehr im DAV, kritisiert die "weiter verzögerte Teilnahme der Justiz an der digitalen Transformation" und betont: "Zumal die Anwaltschaft mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) die Vorteile der Digitalisierung schon seit Jahren für sich zu nutzen gelernt hat." Mit dem beA sei die Anwaltschaft bereits vor Jahren "in Vorleistung" gegangen: "Seit 2018 mussten wir digital empfangsbereit sein, seit 2022 dürfen wir mit Gerichten nur noch digital über das beA kommunizieren. Insgesamt existiert das beA seit fast zehn Jahren! Über 160.000 Anwältinnen und Anwälte haben das geschafft. Wie lang soll es noch dauern, bis die Justiz mitzieht?" Die Bundesrechtsanwaltskammer fordert in ihrer Stellungnahme, die verbleibenden Monate bis zum 1. Januar 2026 entschlossen zu nutzen, Umsetzungshemmnisse zu beseitigen und Ressourcen zu bündeln. Ziel müsse bleiben, Medienbrüche zu vermeiden und bundeseinheitliche E-Aktenführung zu forcieren. Ein funktionierender Rechtsstaat dürfe sich keine weitere Verschleppung digitaler Infrastruktur leisten.
Aktuelle Stellenangebote
Meistgelesene Artikel
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei: