Fünf Jahre nach Einführung zeigt sich – die Abschlussprüferreform hat ihre zentralen Ziele verfehlt und verschärft den Fachkräftemangel.
Big Four-Dominanz ungebrochen trotz Regulierungswelle
Die Marktkonzentration im deutschen Wirtschaftsprüfungsmarkt bleibt unverändert hoch. Deloitte, EY, KPMG und PwC prüfen 38 der 40 DAX-Unternehmen und vereinen über die Hälfte des Gesamtmarktumsatzes von 21,3 Milliarden Euro auf sich. Das erklärte Ziel des Gesetzgebers, die Marktmacht der Big Four aufzubrechen, ist damit gescheitert. In diesem Zuge war nach dem Wirecard-Skandal das so genannte Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) erlassen worden.
Dietmar Prümm, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter des Geschäftsbereichs Assurance bei PwC Deutschland, sieht darin kein Problem: „Wir sehen aktuell einen gesunden WP-Markt mit einem kompetitiven, funktionierenden Wettbewerb. Als PwC sind wir bei Ausschreibungen immer in einer Wettbewerbssituation mit einer Vielzahl an Gesellschaften. Dies begrüßen wir ausdrücklich." Auch IDW-Vorstandssprecherin Melanie Sack argumentiert, Marktkonzentration sei unproblematisch, solange der Markt funktioniere.
Haftungsverschärfung vertreibt mittelständische Prüfer
Die drastische Ausweitung der Haftungsrisiken zeigt kontraproduktive Effekte. Mit dem FISG wurde die Haftungssumme bei kapitalmarktorientierten Unternehmen auf 16 Millionen Euro erhöht, bei Nicht-PIE-Unternehmen auf 1,5 Millionen Euro. Entscheidend: Bei grober Fahrlässigkeit haften WP-Gesellschaften nun unbegrenzt.
„Der Unterschied zwischen ‚Fahrlässigkeit' und ‚grober Fahrlässigkeit' ist hauchdünn und schwer kalkulierbar", erklärt Melanie Sack. „Die verschärfte Haftung hat nicht nur keinen Einfluss auf die Prüfqualität gehabt, sondern die Zahl der WP-Gesellschaften reduziert, die kapitalmarktorientierte Unternehmen prüfen."
Die Regelung verschärft zusätzlich den Fachkräftemangel: „Gleichzeitig wollen weniger Wirtschaftsprüfer PIE-Unternehmen prüfen, da die persönlichen Haftungsgrenzen angehoben wurden", so Sack. Christoph Schenk, Managing Partner Audit & Assurance bei Deloitte, bestätigt: „Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels muss das Berufsfeld des Abschlussprüfers für Nachwuchstalente attraktiver werden. Gesetzliche Regelungen wie das verschärfte Bilanzstrafrecht tragen dazu nicht bei."
Fee Cap-Regelung verursacht Ineffizienzen
Die Streichung der Ausnahmemöglichkeit beim Fee Cap, der Honorare für Nichtprüfungsleistungen auf 70 Prozent des dreijährigen Durchschnitts der Abschlussprüfungshonorare begrenzt, führt zu zusätzlichen Kosten. Besonders bei Comfort Letters, in denen Wirtschaftsprüfer Finanzinformationen in Wertpapierprospekten bestätigen, zeigen sich die Probleme.
„Nun muss ein externer Wirtschaftsprüfer beauftragt werden, der sich erst einmal in das Unternehmen einarbeiten muss, was der Abschlussprüfer nicht müsste. Das sorgt bei den Unternehmen für zusätzliche und in unseren Augen unnötige Kosten", kritisiert Sack. Auch die Blacklist für Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen habe keine Qualitätssteigerung gebracht: „Die wahrgenommene Unabhängigkeit mag dadurch zugenommen haben, die tatsächliche Unabhängigkeit wird weiterhin von der Grundhaltung des Abschlussprüfers bestimmt."
Rotationspflicht: Streit um Qualitätseffekte
Während das IDW 2021 prognostizierte, die Rotationspflicht nach zehn Jahren würde die Prüfqualität verschlechtern, da „mandantenspezifisches Know-how nicht kurzfristig auf den neu bestellten Abschlussprüfer transferiert werden" könne, widerspricht Apas-Leiter Naif-Raffael Kanwan dieser Einschätzung.
„Die kritische Grundhaltung des Abschlussprüfers ist elementar für die Durchführung einer Abschlussprüfung", sagt Kanwan. Übermäßige Nähe zum geprüften Unternehmen gefährde den erforderlichen professionellen Skeptizismus. „Dem wirken unter anderem die Vorschriften zur externen und internen Rotation entgegen." Die stärkere Regulierung der Unabhängigkeit habe vermutlich sogar zu mehr Prüfungsqualität beigetragen.
Allerdings zeigt sich im PIE-Bereich ein „im Verlauf der Jahre zwischen 32 und 52 Prozent schwankender Anteil der Prüfungsmandate mit mindestens einer Fehlerfeststellung, dass noch Verbesserungspotential in Bezug auf die Prüfungsqualität vorhanden ist", räumt Kanwan ein.
Positive Effekte bei Governance und Meldepflichten
Nicht alle Neuerungen werden kritisch bewertet. Die Stärkung der Corporate-Governance-Strukturen, etwa durch Prüfungsausschüsse im Aufsichtsrat, hebt Sack positiv hervor. Schenk bestätigt: „Für die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer sowie für die Überwachung der Steuerungs- und Kontrollsysteme durch den Aufsichtsrat ist dies ein wesentlicher Schritt."
Die Lockerung der Verschwiegenheitspflicht ermöglicht es Abschlussprüfern nun, die Bafin bei Unregelmäßigkeiten direkt zu informieren – zuvor durften sie nur den Aufsichtsrat einbinden.
Fazit: Wirecard-Skandal wäre nicht verhindert worden
Die Gesamtbilanz fällt ambivalent aus. Sack ist überzeugt, dass das FISG den Wirecard-Skandal nicht verhindert hätte und die verschärfte Haftung sogar schädlich sei. Ihr Grundsatz: „Markteingriffe sollten nur vorgenommen werden, wenn ein Markt nicht funktioniert." Schenk sieht trotz der Reformen Potenziale bei der integrierten Betrachtung von Prüfungsfokus, -umfang und -ansatz, „beispielsweise auf die Prüfung der internen Kontrollsysteme und des Risikomanagements der Mandanten."
Verwandte Artikel
Aktuelle Stellenangebote
Meistgelesene Artikel
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:



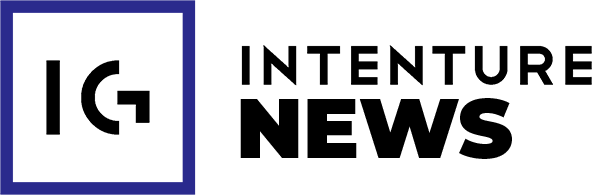


.jpg)

.jpg)










